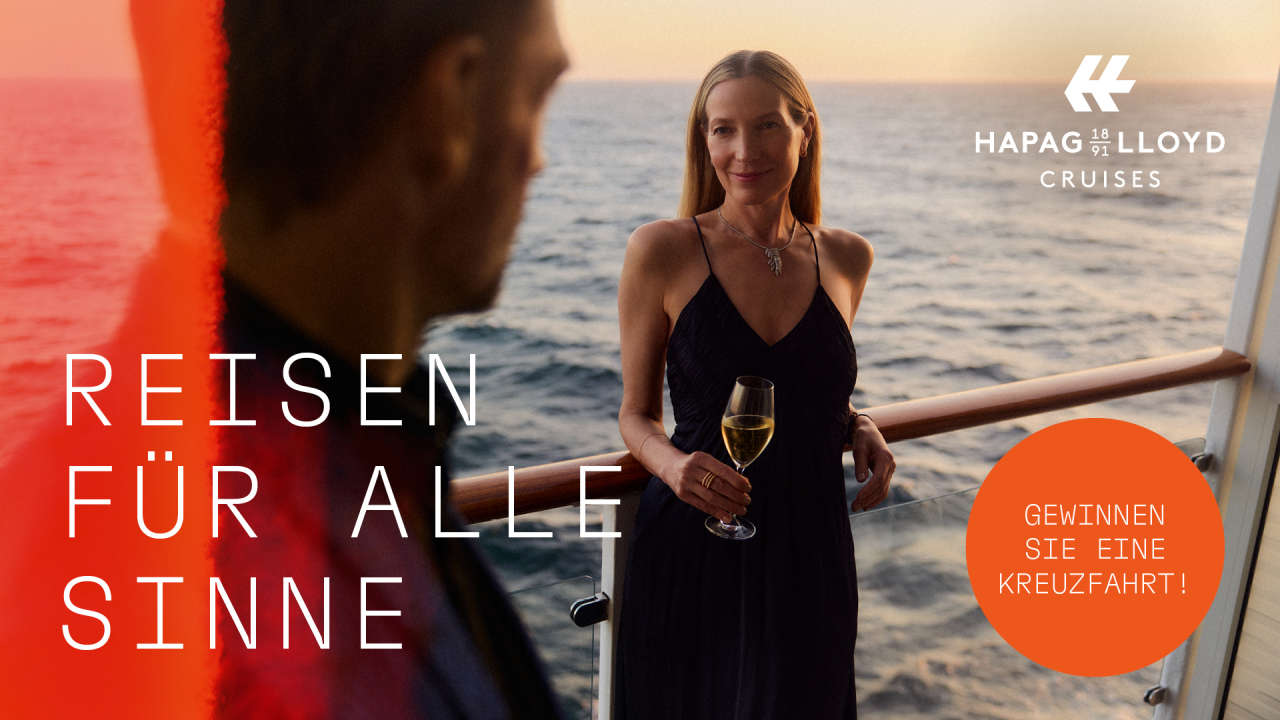Bilder des Tages
Wäre das Thema nicht so ernst, könnte man diesen Beitrag mit einem Witzchen beginnen: durchaus denkbar, dass Greenkeeper demnächst eine Zusatzausbildung bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) oder bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) absolvieren müssen. Schlechter Scherz. Während Golfdeutschland der neuen Saison entgegenfiebert und Unentwegte sowieso den Unbilden der Witterung trotzen, tragen die Klimaforscher zur Flut der schlechten Nachrichten teil.
Ein Planet, der rasant auf den Kipppunkt zusteuert
Genau, Flut. Dass der Klimawandel Extremwetter begünstigt und die Erderwärmung Polkappen abtauen, Gletscher schmelzen, die Ozeane sich ausdehnen und den Meeresspiegel ansteigen lässt, ist Allgemeinwissen, aber noch nicht in manchen Betonschädel vorgedrungen. Es erscheint als Luxusproblem, diesen Umstand für ein Spiel zu deklinieren, wenn der gesamte Planet rasant auf den Kipppunkt zusteuert, ab dem sich nichts mehr revidieren lässt. Verschobene Jahreszeiten, Starkregenereignisse, Hitze und Dürre, sinkende Grundwasserspiegel, Überflutungen und Erosion stellen ebenso die Golfgilde vor Herausforderungen. Und es wird absehbar nicht besser.
Zu 90 Prozent ein Anstieg um 1,90 Meter
Forscher der Nanyang Technological University in Singapur und der niederländischen TU Delft warnen, dass der Meeresspiegel bis zum Jahr 2100 weitaus höher ansteigen könnte als aktuell angenommen wird: um 1,90 Meter maximal, das mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent. Bislang war der Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) von einem Anstieg des Meeresspiegels in einer Größenordnung zwischen 60 und 100 Zentimetern bis 2100 ausgegangen, die Wahrscheinlichkeit wurde mit 66 Prozent beziffert.
Strände in der ganzen Welt unter Wasser
Folgt man der neuen Projektion, könnte die Hälfte der weltweiten Sandstrände bis zum Ende des Jahrhunderts verschwunden sein, heißt es in der Studie, die Ende 2024 in der Fachzeitschrift Nature Climate Change vorgestellt wurde. Beispielhaft werden die Küsten in Frankreich, Spanien, Kalifornien, Florida, Brasilien, in der Türkei oder in Australien angeführt. Womöglich stehen weite Bereiche der deutschen Ostseeküste gleichfalls irgendwann unter Wasser. Die Folgen für Ökosysteme und die hinter den Stränden liegenden Gemeinwesen wären unabsehbar. Zur Verdeutlichung: 40 Prozent der Weltbevölkerung leben in Küstenregionen. Und manche von uns spielen dort liebend gern Golf.
Betroffen auch die Küsten, an denen Golf entstanden ist
Damit ist der Schwenk vollzogen. Denn dort ist das Spiel entstanden, wie wir es heute kennen: auf den kargen Böden der britischen Inseln an Nordsee oder Atlantik, die allenfalls Schwingelgräsern und Schafen zur Existenzgrundlage taugten und den Städtern als Tummelplatz für Geländespiele. Womöglich auch dem gelangweilten Schäfer als Parcours, der mit dem gekrümmten Ende seines Hirtenstabs Kiesel in Kaninchenlöcher schlug, wie die Mär von der Golfentstehung uns weismachen will. Jedenfalls: auf den Links.
Auf Sand und nah am Wasser gebaut
Bis heute wird über die Herkunft des Worts gestritten – vom altenglischen hlinc (dürr, unfruchtbar) oder als Begriff für das Bindeglied zwischen der See und dem nutzbaren Agrarland, zwischen Wellenschlag und Stadtmauer. Sei’s drum, Linksgolf ist Golf in Reinform, die genuine Form des Spiels: ungekünstelt, urwüchsig, hart und spröde wie das Terrain, den Einflüssen von Wind und Wetter schutzlos ausgeliefert. Deswegen müssen solche Nachrichten – unabhängig vom globalen Gräuel – jeden aufschrecken, der Golf liebt, as it was meant to be: auf Sand und nah am Wasser gebaut.
Sehnsuchtsorte und Pilgerstätten
Linksplätze sind Sehnsuchtsorte und Pilgerstätten für Puristen, nationale Heiligtümer. „Sie sind ein Erbe, das bewahrt und erhalten werden muss., denn sie verkörpern die Geschichte des Spiels“, schreibt der australische Autor David Worley in dem Bildband Journey Through the Links. 150 bis 160 originäre Plätze gibt es noch, ruhmreiche Wiesen wie den Old Course in St. Andrews, Alma Mater und heiliger Gral allen Golfwesens, von der Natur geschaffen und vom Menschen nur verfeinert.
Mahnmal des menschengemachten Missstands?
Nun kann es sein, dass man beim 200. Jubiläum der Open Championship im Jahr 2060 allenfalls noch per Ruderboot zur Swilcan Bridge kommt, während die Nordsee gegen den steinernen Bogen schwappt. Klingt lustig, ist es jedoch mitnichten, wenn eine legendäre Landmarke des Golfsports zum Mahnmal des menschengemachten Missstands wird. Großbritanniens führende Umweltorganisation The Climate Coalition, ein Verbund von 130 Organisationen wie WWF, Greenpeace oder Oxfam, die sich mit den Auswirkungen des Klimawandels beschäftigen, hat 2021 genau das prognostiziert und über das von führenden Medien betriebene Nachrichtenportal Climate Central verbreitet; die schottische Tageszeitung The Courier mit Sitz im gut 20 Kilometer entfernten Dundee hat die Horrorvision illustriert.
Beim R&A ist man ziemlich besorgt
Bei den Golfsport-Sachwaltern vom R&A hat man den Ernst der Lage erkannt und ist ziemlich besorgt. „Wir bekommen das jetzt zu spüren, weil immer mehr Löcher unbespielbar, Plätze im Winter geschlossen und professionelle Turniere gestört werden“, sagt Steve Isaac, Direktor für Nachhaltigkeit. „Ohne eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die den Klimawandel vorantreiben, wird der Meeresspiegel um mehr als einen Meter ansteigen und extrem nasse Winter werden zur Norm.“
Forschungsprojekt mit der Uni von St. Andrews
2018 hat der R&A daher einen Coastal Change Action Plan als signifikanten Punkt ins Umwelt- und Nachhaltigkeitsprogramm Golf Course 2030 aufgenommen und mit der Universität von St. Andrews ein Forschungsprojekt angestrengt, das die Situation aller Linkskurse in Großbritannien und Irland erfassen, die Auswirkungen des Klimawandels auf Pflege und Bespielbarkeit untersuchen und eine tief gehende Analyse samt Lösungsmöglichkeiten erarbeiten soll. Dazu gehört eine Studie über Blue Carbon. So wird das Treibhausgas Kohlendioxid bezeichnet, das von den weltweiten Meeres- und Küstenökosystemen und folglich auch von den Habitaten rund um Linkskurse gebunden werden kann und damit nicht mehr zur Erderwärmung beiträgt.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
„Golf soll weiterhin Hunderte von Jahren möglich sein“
2020 wiederum wurden mit dem St. Andrews Links Trust, der die sieben öffentlichen Kurse rund um Old Grey Town verwaltet, 650.000 britische Pfund (seinerzeit 757.500 Euro) für diverse Maßnahmen in den Küstenbereichen von St. Andrews gegen Überschwemmungen und Erosion zur Verfügung gestellt. „Seit 600 Jahren wird bei uns Golf gespielt. Und das soll weiterhin Hunderte von Jahren möglich sein“, so ein Sprecher des Links Trust. Freilich, es könnte ein frommer Wunsch bleiben.
Pikanterie am Rande: Die Probleme in St. Andrews haben einen Touch von Revanchismus. Die Nordsee versucht lediglich, verlorenen Boden zurückzuerobern. Im Wortsinn. In den 1840er-Jahren wurde unter der Leitung von Sir Hugh Lyon Playfair das Meer zurückgedrängt und ein Areal trockengelegt, auf dem seit 1854 das ikonische Clubhaus des Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews steht. 1875 wiederum errichtete die Stadt einen Deich, der den Namen Bruce Embankment bekam und aus ausrangierten, mit Erde befüllten und mit Gras bewachsenen Booten bestand. Die so gewonnene zusätzliche Fläche ermöglichte es Old Tom Morris, dem Keeper of the Green, den ersten Abschlag und das 18. Grün neu zu arrangieren.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Das Beispiel Montrose Links
Wer sich regelmäßig auf Küstenkursen tummelt, erlebt, wie der Klimawandel und dessen Auswüchse in Form von Stürmen und Springfluten oder dem Wellenschlag und der Gezeitenkraft eines steigenden Meeresspiegels allerorten an den Plätzen nagen. Eine gute Autostunde nördlich von St. Andrews liegen die Montrose Links, das fünftälteste Golfgeläuf der Welt. Seit 1562 werden dort Bälle geschlagen. Der gleichnamige Championshipkurs verläuft entlang der meistgefährdeten Stelle an der schottischen Ostküste. Stürme und Springfluten machen dem Platz schwer zu schaffen, unerbittlich wäscht die Nordsee das sandige Fundament von Fairways und Grüns aus. Steter Tropfen höhlt den Stein: Immer wieder lösen sich begraste Brocken und stürzen auf den Strand, so wie ein Gletscher kalbt. Das ursprüngliche sechste Loch ist seit 1994 verschwunden, insgesamt vier Bahnen mussten bereits verkürzt oder landeinwärts verlegt werden.
Dünen verlieren Festigkeit, Platz verliert den Unterbau ans Meer
Im Dezember 2018 fegte der Sturm Deidre mit derartiger Wucht über die Küste, dass der Platz mit Hunderten von Tonnen Sand eingeweht wurde – weil die Dünen ihre Festigkeit verloren haben und soweit erodiert sind, dass sie keinen Schutz mehr bieten. Laut Berechnungen des Forschers Fraser Milne von der Universität Dundee hat Montrose in den vergangenen 35 Jahren bis zu einer Tiefe von 70 Metern Strand und Küstenböschung verloren. Sand- und Steinaufschüttungen, gewonnen durch die Vertiefung des Hafenbeckens von Port Montrose, alles in allem eine Investition von knapp 600.000 Euro, verlangsamen allenfalls den Verfall.

Erschreckende Veränderungen: Montrose, dem fünftältesten Golfplatz der Welt, droht das Schicksal, irgendwann einfach weggespült zu werden. (Foto: Montrose Golf Links)
Aus einer Prognose von zwei Metern Erosion wurden sieben Meter
Das Problem wächst überproportional. „Wir hatten die Prognose, dass sich das Meer jährlich vielleicht 1,5 bis zwei Meter vorarbeitet“, zitiert die BBC den ehemaligen Club-Chairman John Adams. „Aber allein 2023 wurden sieben Meter abgetragen. Noch mal sieben Meter, und die Nordsee ist Mitte Fairway angelangt. In ein paar Jahrzehnten hat sie dann die Stadt erreicht.“ Berechnungen gehen davon aus, dass die See binnen der nächsten 40 Jahre um weitere 80 Meter ins Land eindringt beziehungsweise dieses abträgt. Montrose, diesem Kleinod aus dem Lehrbuch über Linksgolf, droht das Schicksal, irgendwann einfach weggespült zu werden.
Wer nach all den düsteren Prognosen noch weiterlesen mag, findet in der Folge weitere erschreckende Beispiele.
Von Sligo bis Dornoch: Dünen erodieren, die Bedrohung durch Überflutung steigt
Anlässlich der Weltklima-Konferenz COP26 von 2021 in Glasgow hat die BBC Dr. Jim Hansom von der Universität Glasgow zum Thema interviewt. „Uns gehen überall die Küstensedimente aus“, sagte der Wissenschaftler, der eine Forschungsgruppe leitet, die sich mit Prognosen zur Küstenerosion beschäftigt. „Je weiter die Dünen erodieren, desto realistischer wird die Bedrohung dauerhafter Überflutungen.“ Sein Kollege Martin Hurst geht für Schottland davon aus, dass im Worst Case infrastrukturelle Vermögenswerte in Küstennähe in einer Größenordnung von 1,2 Milliarden Pfund gefährdet sind. Dabei geht es dann nicht mehr allein um Golfplätze. Von denen grenzt immerhin jeder sechste an die Küste, die andererseits nur zu sechs Prozent mit Schutzmaßnahmen gegen die zerstörerische Kraft des Wassers ausgestattet sind. Zum Vergleich: In England und Wales werden 44 Prozent der Küste protektiert, in Nordirland sind es 32 Prozent.
Wehrhafte Vegetation als Küstenschutz
Noch ein Beispiel: Royal Dornoch in den schottischen Highlands wird in sämtlichen Rankings unter den Besten der Welt geführt. Die zerfledderte Küstenlinie des Dornoch Firth ist gleichermaßen anfällig für die zerstörerische Wirkung des Wassers, besonders betroffen ist Dornochs zweiter Kurs, der Struie. 2018 ließ man an prekären Stellen unter Zuhilfenahme von wissenschaftlicher Betreuung Hunderte von Salzwasser-resistenten Gewächsen pflanzen, um mit solch wehrhafter Vegetation den natürlichen Küstenschutz wiederherzustellen.
Die Frühjahrsstürme an der Küste von Westward Ho!
Ortswechsel. Der Royal North Devon Golf Club ist Englands ältester Golfplatz, wurde 1864 gegründet. General Manager Mark Evans weist seit Jahren darauf hin, dass vor allem die Frühjahrsstürme den Flächen des fast 160 Jahre alten Linkskurses in Westward Ho! zusetzen. Der achte Abschlag wurde 2018 beim Sturm Eleanor komplett ins Meer gewaschen, anschließend provisorisch angelegt und 2023 im Zuge weiterer Bahnenverschiebungen neu angelegt. Überdies gilt das siebte Grün als besonders gefährdet.
„Wenn das so weitergeht, haben wir vielleicht noch 20 Jahre“
Nach Angaben von Evans ist die Erosion seit 2015 in manchen Bereichen mehr als 15 Meter tief ins Land vorgedrungen: „Unser Platz ist seit Bestehen immer wieder vom Meer angegriffen worden. Wenn das so weitergeht, haben wir vielleicht noch 20 Jahre.“ Ähnliches gilt für über 100 weitere Anlagen an der gesamten Ostküste von Großbritannien, wie ein Weißbuch zur Zukunftssicherung des Spiels angibt, das von führenden Vertretern der Golfindustrie verfasst worden ist.
Ein steinerner Wall vor den Links von Portrush
In Nordirland und Irland setzt man auf Wellenbrecher, die aus Beton gegossen werden, will damit die Kraft der Gezeiten und der Stürme eindämmen und die Sedimente der Dünen schützen. Nur Fans der Schadenfreude wird belustigen, dass 2020 ausgerechnet Donald Trumps Doonbeg Resort der Bau einer Mauer wider das Meer verweigert worden ist. Royal Portrush, in diesem Jahr zum zweiten Mal nach 2019 Bühne für das weltälteste Major, hat den steinernen Wall vor kurzem um 20 Meter erweitert, um alle Risiken für die 153. Open Championship im Juli auszuschließen.
Die Aussichten sind apokalyptisch
Die Liste der Schadensmeldungen ist lang – egal, ob Fortrose & Rosemarkie in den Highlands, Rosapenna, Carne, Enniscrone oder County Sligo in Irland, Gorleston in England. Überall sind die Aussichten apokalyptisch, ein Happy End scheint nicht in Sicht. „Selbst bei einer Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen bis 2100 wird sich das Klima über das 21. Jahrhundert hinaus ändern und insbesondere der Meeresspiegel weiter steigen, der wegen der großen Wärmeaufnahmekapazität langsamer auf den Klimawandel reagiert“, heißt es beim Umweltbundesamt in einem Beitrag vom 29. Januar 2025 mit dem Titel „Zu erwartende Klimaänderungen bis 2100“.
„Golfplätze werden sukzessive ins Meer bröckeln“
Deswegen hat The Climate Coalition wohl recht mit der These: „Golfplätze werden sukzessive ins Meer bröckeln.“ Wobei abgesoffene oder vom Sturm verwehte oder zu hartbackenem Brot verdorrte Golfplätze das geringste Problem auf einem nicht mehr grünen Globus sind, wenn die Menschheit das Rennen gegen die Erderwärmung endgültig verliert, in dem sie bereits jetzt so arg im Hintertreffen liegt.

County Sligo: Man kann sich vorstellen, wie sehr ein Anstieg des Meeresspiegels die Golfanlage aus dem Ende des 19. Jahrhunderts verändern könnte.(Foto: Michael F. Basche)